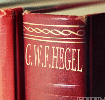|
I. Innere Verfassung für sich
§ 272
Die Verfassung ist vernünftig, insofern der Staat seine Wirksamkeit nach der Natur des Begriffs in sich unterscheidet und bestimmt, und zwar so, daß jede dieser Gewalten selbst in sich die Totalität dadurch ist, daß sie die anderen Momente in sich wirksam hat und enthält und daß sie, weil sie den Unterschied des Begriffs ausdrücken, schlechthin in seiner Idealität bleiben und nur ein individuelles Ganzes ausmachen.
Es ist über Verfassung wie über die Vernunft selbst in neueren Zeiten unendlich viel Geschwätze, und zwar in Deutschland das schalste durch diejenigen in die Welt gekommen, welche sich überredeten, es am besten und selbst mit Ausschluß aller anderen und am ersten der Regierungen zu verstehen, was Verfassung sei, und die unabweisliche Berechtigung darin zu haben meinten, daß die Religion und die Frömmigkeit die Grundlage aller dieser ihrer Seichtigkeiten sein sollte.
Es ist kein Wunder, wenn dieses Geschwätze die Folge gehabt hat, daß vernünftigen Männern die Worte Vernunft, Aufklärung, Recht usf. wie Verfassung und Freiheit ekelhaft geworden sind und man sich schämen möchte, noch über politische Verfassung auch mitzusprechen. Wenigstens aber mag man von diesem Überdrusse die Wirkung hoffen, daß die Überzeugung allgemeiner werde, daß eine philosophische Erkenntnis solcher Gegenstände nicht aus dem Räsonnement, aus Zwecken, Gründen und Nützlichkeiten, noch viel weniger aus dem Gemüt, der Liebe und der Begeisterung, sondern allein aus dem Begriffe hervorgehen könne und daß diejenigen, welche das Göttliche für unbegreiflich und die Erkenntnis des Wahren für ein nichtiges Unternehmen halten, sich enthalten müssen, mitzusprechen. Was sie aus ihrem Gemüte und ihrer Begeisterung an unverdautem Gerede oder an Erbaulichkeit hervorbringen, beides kann wenigstens nicht die Prätention auf philosophische Beachtung machen.
Von den kursierenden Vorstellungen ist, in Beziehung auf den § 269, die von der notwendigen Teilung der Gewalten des Staats zu erwähnen, - einer höchst wichtigen Bestimmung, welche mit Recht, wenn sie nämlich in ihrem wahren Sinne genommen worden wäre, als die Garantie der öffentlichen Freiheit betrachtet werden konnte, - einer Vorstellung, von welcher aber gerade die, welche aus Begeisterung und Liebe zu sprechen meinen, nichts wissen und nichts wissen wollen; denn in ihr ist es eben, wo das Moment der vernünftigen Bestimmtheit liegt. Das Prinzip der Teilung der Gewalten enthält nämlich das wesentliche Moment des Unterschiedes, der realen Vernünftigkeit; aber wie es der abstrakte Verstand faßt, liegt darin teils die falsche Bestimmung der absoluten Selbständigkeit der Gewalten gegeneinander, teils die Einseitigkeit, ihr Verhältnis zueinander als ein Negatives, als gegenseitige Beschränkung aufzufassen. In dieser Ansicht wird es eine Feindseligkeit, eine Angst vor jeder, was jede gegen die andere als gegen ein Übel hervorbringt, mit der Bestimmung, sich ihr entgegenzusetzen und durch diese Gegengewichte ein allgemeines Gleichgewicht, aber nicht eine lebendige Einheit zu bewirken.
Nur die Selbstbestimmung des Begriffs in sich, nicht irgend andere Zwecke und Nützlichkeiten, ist es, welche den absoluten Ursprung der unterschiedenen Gewalten enthält und um derentwillen allein die Staatsorganisation als das in sich Vernünftige und das Abbild der ewigen Vernunft ist.
- Wie der Begriff und dann in konkreter Weise die Idee sich an ihnen selbst bestimmen und damit ihre Momente abstrakt der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit setzen, ist aus der Logik - freilich nicht der sonst gang und gäben - zu erkennen. Überhaupt das Negative zum Ausgangspunkt zu nehmen und das Wollen des Bösen und das Mißtrauen dagegen zum Ersten zu machen und von dieser Voraussetzung aus nun pfiffigerweise Dämme auszuklügeln, die als [Bedingung ihrer] Wirksamkeit nur gegenseitiger Dämme bedürfen, charakterisiert dem Gedanken nach den negativen Verstand und der Gesinnung nach die Ansicht des Pöbels (s. oben § 244).
- Mit der Selbständigkeit der Gewalten, z. B. der, wie sie genannt worden sind, exekutiven und der gesetzgebenden Gewalt, ist, wie man dies auch im großen gesehen hat, die Zertrümmerung des Staats unmittelbar gesetzt oder, insofern der Staat sich wesentlich erhält, der Kampf, daß die eine Gewalt die andere unter sich bringt, dadurch zunächst die Einheit, wie sie sonst beschaffen sei, bewirkt und so allein das Wesentliche, das Bestehen des Staats rettet.
Zusatz. Im Staate muß man nichts haben wollen, als was ein Ausdruck der Vernünftigkeit ist. Der Staat ist die Welt, die der Geist sich gemacht hat; er hat daher einen bestimmten, an und für sich seienden Gang. Wie oft spricht man nicht von der Weisheit Gottes in der Natur; man muß aber ja nicht glauben, daß die physische Naturwelt ein Höheres sei als die Welt des Geistes, denn so hoch der Geist über der Natur steht, so hoch steht der Staat über dem physischen Leben. Man muß daher den Staat wie ein Irdisch-Göttliches verehren und einsehen, daß, wenn es schwer ist, die Natur zu begreifen, es noch unendlich herber ist, den Staat zu fassen. Es ist höchst wichtig, daß man in neueren Zeiten bestimmte Anschauungen über den Staat im allgemeinen gewonnen hat und daß man sich soviel mit dem Sprechen und Machen von Verfassungen beschäftigte.
Damit ist es aber noch nicht abgemacht; es ist nötig, daß man zu einer vernünftigen Sache auch die Vernunft der Anschauung mitbringe, daß man wisse, was das Wesentliche sei und daß nicht immer das Auffallende das Wesentliche ausmache.
Die Gewalten des Staates müssen so allerdings unterschieden sein, aber jede muß an sich selbst ein Ganzes bilden und die anderen Momente in sich enthalten. Wenn man von der unterschiedenen Wirksamkeit der Gewalten spricht, muß man nicht in den ungeheuren Irrtum verfallen, dies so anzunehmen, als wenn jede Gewalt für sich abstrakt dastehen sollte, da die Gewalten vielmehr nur als Momente des Begriffs unterschieden sein sollen. Bestehen die Unterschiede dagegen abstrakt für sich, so liegt am Tage, daß zwei Selbständigkeiten keine Einheit ausmachen können, wohl aber Kampf hervorbringen müssen, wodurch entweder das Ganze zerrüttet wird oder die Einheit durch Gewalt sich wieder herstellt. So hat in der französischen Revolution bald die gesetzgebende Gewalt die sogenannte exekutive, bald die exekutive die gesetzgebende Gewalt verschlungen, und es bleibt abgeschmackt, hier etwa die moralische Forderung der Harmonie zu machen. Denn wirft man die Sache aufs Gemüt, so hat man freilich sich alle Mühe erspart; aber wenn das sittliche Gefühl auch notwendig ist, so hat es nicht aus sich die Gewalten des Staates zu bestimmen.
Worauf es also ankommt ist, daß, indem die Bestimmungen der Gewalten an sich das Ganze sind, sie auch alle in der Existenz den ganzen Begriff ausmachen. Wenn man gewöhnlich von dreien Gewalten, der gesetzgebenden, der exekutiven und der richterlichen redet, so entspricht die erste der Allgemeinheit, die zweite der Besonderheit, aber die richterliche ist nicht das Dritte des Begriffs, denn ihre Einzelheit liegt außer jenen Sphären.
§ 273
Der politische Staat dirimiert sich somit in die substantiellen Unterschiede:
a) die Gewalt, das Allgemeine zu bestimmen und festzusetzen, - die gesetzgebende Gewalt,
b) die Subsumtion der besonderen Sphären und einzelnen Fälle unter das Allgemeine, - die Regierungsgewalt,
c) die Subjektivität als die letzte Willensentscheidung, - die fürstliche Gewalt, in der die unterschiedenen Gewalten zur individuellen Einheit zusammengefaßt sind, die also die Spitze und der Anfang des Ganzen, der konstitutionellen Monarchie, ist.
Die Ausbildung des Staats zur konstitutionellen Monarchie ist das Werk der neueren Welt, in welcher die substantielle Idee die unendliche Form gewonnen hat. Die Geschichte dieser Vertiefung des Geistes der Welt in sich oder, was dasselbe ist, diese freie Ausbildung, in der die Idee ihre Momente - und nur ihre Momente sind es - als Totalitäten aus sich entläßt und sie eben damit in der idealen Einheit des Begriffs enthält, als worin die reelle Vernünftigkeit besteht, - die Geschichte dieser wahrhaften Gestaltung des sittlichen Lebens ist die Sache der allgemeinen Weltgeschichte.
Die alte Einteilung der Verfassungen in Monarchie, Aristokratie und Demokratie hat die noch ungetrennte substantielle Einheit zu ihrer Grundlage, welche zu ihrer inneren Unterscheidung (einer entwickelten Organisation in sich) und damit zur Tiefe und konkreten Vernünftigkeit noch nicht gekommen ist. Für jenen Standpunkt der alten Welt ist daher diese Einteilung die wahre und richtige; denn der Unterschied als an jener noch substantiellen, nicht zur absoluten Entfaltung in sich gediehenen Einheit ist wesentlich ein äußerlicher und erscheint zunächst als Unterschied der Anzahl (Enzyklop. der philos. Wissensch., § 82) derjenigen, in welchen jene substantielle Einheit immanent sein soll. Diese Formen, welche auf solche Weise verschiedenen Ganzen angehören, sind in der konstitutionellen Monarchie zu Momenten herabgesetzt; der Monarch ist Einer; mit der Regierungsgewalt treten Einige und mit der gesetzgebenden Gewalt tritt die Vielheit überhaupt ein. Aber solche bloß quantitative Unterschiede sind, wie gesagt, nur oberflächlich und geben nicht den Begriff der Sache an.
Es ist gleichfalls nicht passend, wenn in neuerer Zeit soviel vom demokratischen, aristokratischen Elemente in der Monarchie gesprochen worden ist; denn diese dabei gemeinten Bestimmungen, eben insofern sie in der Monarchie stattfinden, sind nicht mehr Demokratisches und Aristokratisches.
- Es gibt Vorstellungen von Verfassungen, wo nur das Abstraktum von Staat oben hingestellt ist, welches regiere und befehle, und es unentschieden gelassen und als gleichgültig angesehen wird, ob an der Spitze dieses Staates Einer oder Mehrere oder Alle stehen. - "Alle diese Formen", sagt so Fichte in seinem Naturrecht94) , 1. Teil, S. 196, "sind, wenn nur ein Ephorat (ein von ihm erfundenes, sein sollendes Gegengewicht gegen die oberste Gewalt) vorhanden ist, rechtsgemäß und können allgemeines Recht im Staate hervorbringen und erhalten." - Eine solche Ansicht (wie auch jene Erfindung eines Ephorats) stammt aus der vorhin bemerkten Seichtigkeit des Begriffes vom Staate. Bei einem ganz einfachen Zustande der Gesellschaft haben diese Unterschiede freilich wenig oder keine Bedeutung, wie denn Moses in seiner Gesetzgebung für den Fall, daß das Volk einen König verlange, weiter keine Abänderung der Institutionen, sondern nur für den König das Gebot hinzufügt, daß seine Kavallerie, seine Frauen und sein Gold und Silber nicht zahlreich sein solle (s. Mose 17, 16 ff.). - Man kann übrigens in einem Sinne allerdings sagen, daß auch für die Idee jene drei Formen (die monarchische mit eingeschlossen, in der beschränkten Bedeutung nämlich, in der sie neben die aristokratische und demokratische gestellt wird) gleichgültig sind, aber in dem entgegengesetzten Sinne, weil sie insgesamt der Idee in ihrer vernünftigen Entwicklung (§ 272) nicht gemäß sind und diese in keiner derselben ihr Recht und Wirklichkeit erlangen könnte. Deswegen ist es auch zur ganz müßigen Frage geworden, welche die vorzüglichste unter ihnen wäre; - von solchen Formen kann nur historischerweise die Rede sein.
- Sonst aber muß man auch in diesem Stücke, wie in so vielen anderen, den tiefen Blick Montesquieus in seiner berühmt gewordenen Angabe der Prinzipien dieser Regierungsformen95) anerkennen, aber diese Angabe, um ihre Richtigkeit anzuerkennen, nicht mißverstehen. Bekanntlich gab er als Prinzip der Demokratie die Tugend an; denn in der Tat beruht solche Verfassung auf der Gesinnung als der nur substantiellen Form, in welcher die Vernünftigkeit des an und für sich seienden Willens in ihr noch existiert. Wenn Montesquieu aber hinzufügt, daß England im siebzehnten Jahrhundert das schöne Schauspiel gegeben habe, die Anstrengungen, eine Demokratie zu errichten, als ohnmächtig zu zeigen, da die Tugend in den Führern gemangelt habe, - und wenn er ferner hinzusetzt, daß, wenn die Tugend in der Republik verschwindet, der Ehrgeiz sich derer, deren Gemüt desselben fähig ist, und die Habsucht sich aller bemächtigt und der Staat alsdann, eine allgemeine Beute, seine Stärke nur in der Macht einiger Individuen und in der Ausgelassenheit aller habe, - so ist darüber zu bemerken, daß bei einem ausgebildeteren Zustande der Gesellschaft, und bei der Entwicklung und dem Freiwerden der Mächte der Besonderheit, die Tugend der Häupter des Staats unzureichend und eine andere Form des vernünftigen Gesetzes als nur die der Gesinnung erforderlich wird, damit das Ganze die Kraft, sich zusammenzuhalten und den Kräften der entwickelten Besonderheit ihr positives wie ihr negatives Recht angedeihen zu lassen, besitze. Gleicherweise ist das Mißverständnis zu entfernen, als ob damit, daß in der demokratischen Republik die Gesinnung der Tugend die substantielle Form ist, in der Monarchie diese Gesinnung für entbehrlich oder gar für abwesend erklärt, und vollends, als ob Tugend und die in einer gegliederten Organisation gesetzlich bestimmte Wirksamkeit einander entgegengesetzt und unverträglich wäre.
- Daß in der Aristokratie die Mäßigung das Prinzip sei, bringt die hier beginnende Abscheidung der öffentlichen Macht und des Privatinteresses mit sich, welche zugleich sich so unmittelbar berühren, daß diese Verfassung in sich auf dem Sprunge steht, unmittelbar zum härtesten Zustande der Tyrannei oder Anarchie (man sehe die römische Geschichte) zu werden und sich zu vernichten.
- Daß Montesquieu die Ehre als das Prinzip der Monarchie erkennt, daraus ergibt sich für sich schon, daß er nicht die patriarchalische oder antike überhaupt, noch die zu objektiver Verfassung gebildete, sondern die Feudalmonarchie, und zwar insofern die Verhältnisse ihres inneren Staatsrechts zu rechtlichem Privateigentume und Privilegien von Individuen und Korporationen befestigt sind, versteht. Indem in dieser Verfassung das Staatsleben auf privilegierter Persönlichkeit beruht, in deren Belieben ein großer Teil dessen gelegt ist, was für das Bestehen des Staats getan werden muß, so ist das Objektive dieser Leistungen nicht auf Pflichten, sondern auf Vorstellung und Meinung gestellt, somit statt der Pflicht nur die Ehre das, was den Staat zusammenhält.
Eine andere Frage bietet sich leicht dar: wer die Verfassung machen soll. Diese Frage scheint deutlich, zeigt sich aber bei näherer Betrachtung sogleich sinnlos. Denn sie setzt voraus, daß keine Verfassung vorhanden, somit ein bloßer atomistischer Haufen von Individuen beisammen sei. Wie ein Haufen, ob durch sich oder andere, durch Güte, Gedanken oder Gewalt, zu einer Verfassung kommen würde, müßte ihm überlassen bleiben, denn mit einem Haufen hat es der Begriff nicht zu tun.
- Setzt aber jene Frage schon eine vorhandene Verfassung voraus, so bedeutet das Machen nur eine Veränderung, und die Voraussetzung einer Verfassung enthält es unmittelbar selbst, daß die Veränderung nur auf verfassungsmäßigem Wege geschehen könne.
- Überhaupt aber ist es schlechthin wesentlich, daß die Verfassung, obgleich in der Zeit hervorgegangen, nicht als ein Gemachtes angesehen werde; denn sie ist vielmehr das schlechthin an und für sich Seiende, das darum als das Göttliche und Beharrende und als über der Sphäre dessen, was gemacht wird, zu betrachten ist.
Zusatz.
Das Prinzip der neueren Welt überhaupt ist Freiheit der Subjektivität, daß alle wesentlichen Seiten, die in der geistigen Totalität vorhanden sind, zu ihrem Rechte kommend sich entwickeln. Von diesem Standpunkt ausgehend, kann man kaum die müßige Frage aufwerfen, welche Form, die Monarchie oder die Demokratie, die bessere sei. Man darf nur sagen, die Formen aller Staatsverfassungen sind einseitige, die das Prinzip der freien Subjektivität nicht in sich zu ertragen vermögen und einer ausgebildeten Vernunft nicht zu entsprechen wissen.
§ 274
Da der Geist nur als das wirklich ist, als was er sich weiß, und der Staat, als Geist eines Volkes, zugleich das alle seine Verhältnisse durchdringende Gesetz, die Sitte und das Bewußtsein seiner Individuen ist, so hängt die Verfassung eines bestimmten Volkes überhaupt von der Weise und Bildung des Selbstbewußtseins desselben ab; in diesem liegt seine subjektive Freiheit und damit die Wirklichkeit der Verfassung
Einem Volke eine, wenn auch ihrem Inhalte nach mehr oder weniger vernünftige Verfassung a priori geben zu wollen, - dieser Einfall übersähe gerade das Moment, durch welches sie mehr als ein Gedankending wäre. Jedes Volk hat deswegen die Verfassung, die ihm angemessen ist und für dasselbe gehört.
Zusatz.
Der Staat muß in seiner Verfassung alle Verhältnisse durchdringen. Napoleon hat z. B. den Spaniern eine Verfassung a priori geben wollen, was aber schlecht genug ging. Denn eine Verfassung ist kein bloß Gemachtes: sie ist die Arbeit von Jahrhunderten, die Idee und das Bewußtsein des Vernünftigen, inwieweit es in einem Volk entwickelt ist. Keine Verfassung wird daher bloß von Subjekten geschaffen. Was Napoleon den Spaniern gab, war vernünftiger, als was sie früher hatten, und doch stießen sie es zurück als ein ihnen Fremdes, da sie noch nicht bis dahinauf gebildet waren. Das Volk muß zu seiner Verfassung das Gefühl seines Rechts und seines Zustandes haben, sonst kann sie zwar äußerlich vorhanden sein, aber sie hat keine Bedeutung und keinen Wert. Freilich kann oft in Einzelnen sich das Bedürfnis und die Sehnsucht nach einer besseren Verfassung vorfinden, aber daß die ganze Masse von einer solchen Vorstellung durchdrungen werde, ist etwas ganz anderes und folgt erst später nach. Das Prinzip der Moralität, der Innerlichkeit des Sokrates ist in seinen Tagen notwendig erzeugt [worden], aber dazu, daß es zum allgemeinen Selbstbewußtsein geworden ist, gehörte Zeit.
94) Grundlage des Naturrechts, 1796 (§ 16)
95) De l'esprit des lois I, 1. III
|